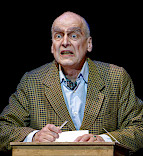European News Agency, 14.11.2025, Nadejda Komendantova
Jugendstiltheater Wien [ENA]. In „Abendsonne“ werden wir in eine melancholische, ironisch gefärbte Kammeroper entführt, die in einer Seniorenresidenz namens „Abendsonne“ spielt. Hier ereignen sich Alter, Sterblichkeit, Wiedergeburt und die spannungsgeladenen Begegnungen zwischen den Generationen in einer ebenso alltäglichen wie metaphysischen Umgebung. Die Inszenierung beginnt mit einigen älteren Bewohnern am Ende ihres Lebens.
Aus der anfänglichen Stille entsteht bald Chaos, als einer der Bewohner, ein pensionierter Arzt, seine Krebsdiagnose erhält und mit Hilfe von Freunden und einer jungen Pflegekraft beginnt, seine „Wiedergeburt“ zu planen. Das Libretto von Kristine Tornquist zeichnet sich durch eine vielschichtige Struktur aus, in der drei miteinander verwobene Dimensionen oder „Zeitebenen“ miteinander verflochten sind: die der Ungeborenen, der Lebenden und der Toten. Diese Bereiche laufen am Spielort der Geschichte, dem Altenheim, ineinander: junge und alte lebende Seelen, wachgerufene Erinnerungen an die Toten und die zukünftige Existenz der noch Ungeborenen treffen in einer Umgebung aufeinander, die selbst zwischen Existenz und Nicht-Existenz liegt.
Die Zeit in Abendsonne ist nicht linear und elastisch; die Grenzen zwischen Kindheit, Geburt, Leben und Tod verschwimmen, und die alternden Protagonisten versuchen, den Lauf der Zeit mit unterschiedlichem Maß an Humor, Verleugnung und Einsicht zu bewältigen. Auf diese Weise wird das Altersheim zu einer Mikrowelt des menschlichen Lebenszyklus, einschließlich seiner grotesken, absurden und tragischen Dimensionen. Der Komponist Tomasz Skweres bezeichnet das Werk als „Tragikomödie des Überlebens“ und merkt an, dass die Partitur bewusst auf Referenzen aus Opern- und Stilistiktraditionen zurückgreift, um dem unaufhaltsamen Fortschreiten der Zeit musikalische Gestalt zu verleihen.
Musikalisch und theatralisch zeichnet sich Abendsonne durch seine Hybridität und sein ständiges Wechselspiel zwischen Ernsthaftigkeit und Absurdität aus. Die Instrumentation ist kammermusikalisch: Das Ensemble umfasst Flöte, Klarinette, Saxophon, Horn, Posaune, Akkordeon, Harfe, Streicher und zwei Perkussionisten. Diese Instrumentierung ermöglicht eine intime und dennoch reichhaltige Klangwelt, die gut zur psychologischen Innerlichkeit und den wechselnden Tonlagen der Oper passt. Skweres' Ansatz integriert stilistische Anspielungen – Momente, die an klassische Oper, Barockmusik oder Techniken des 19. Jahrhunderts erinnern –, die jedoch durch eine moderne Linse verzerrt werden.
Er erklärt, dass die häufigen „schnellen Wechsel zwischen grotesken, absurden Motiven und tragisch-dramatischen Momenten“ symbolisch für die Dramaturgie des Werkes sind. Mit anderen Worten: Das Publikum wird häufig gleichermassen verunsichert, bewegt und amüsiert. Die Inszenierung unter der Regie von Tornquist verstärkt diesen Effekt noch. Das Bühnenbild von Markus Liszt und Michael Liszt verortet die Handlung im Jugendstiltheater am Steinhof (dem Aufführungsort) und nutzt eine Umgebung, die gleichzeitig steril und unheimlich ist: eine von Theatralik durchdrungene Seniorenresidenz.
Die Choreografie von Bärbel Strehlau und die Videoprogrammierung von Germano Milite fügen weitere Bewegungsebenen und eine vermittelte Präsenz hinzu und verwandeln die Residenz in eine Bühne des zeitlichen Wandels, auf der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verschmelzen. Die Kostüme von Nora Scheidl und das Lichtdesign von Alexander Wanko verstärken die thematischen Kontraste zusätzlich: Alter versus Jugend, Routine versus Offenbarung, Stille versus Bewegung. Einer der faszinierendsten Aspekte von Abendsonne ist, dass es Alter und Tod nicht nur mit Melancholie behandelt, sondern als einen Bereich voller Humor, Absurdität und Möglichkeiten. Die Idee, dass ein pensionierter Arzt in der letzten Phase seines Lebens eine „Wiedergeburt” plant, eröffnet Raum für Reflexionen über Handlungsfähigkeit, Transformation und das, was auch dann noch möglich ist, wenn die Zeit abläuft.
Die Sprache des Librettos und die Musikpartitur schaffen gemeinsam eine Atmosphäre, die zugleich intim und weitläufig ist. Tornquists Text verzichtet auf sentimentalen Trost und versetzt seine Figuren stattdessen in schräge Dialoge, Monologe und Chorfragmente, die von nachdenklich über komisch bis surreal reichen. Die Partitur des Komponisten spiegelt dies wider: Manchmal scheint die Musik bekannte Opernklischees zu zitieren oder zu evozieren, aber diese Zitate sind verzerrt oder unterbrochen; was sich wie ein Walzer anfühlt, kann in eine perkussive Einlage übergehen, eine lyrische Passage kann einem Ausbruch von Dissonanzen weichen. Das Zusammenspiel von Tradition und Innovation wird so zu einer Meta-Reflexion über die Zeit selbst: Musikgeschichte, die sich in die Gegenwart einfügt, ähnlich wie die alten und jungen Figuren.
Skweres selbst kommentiert, dass seine musikalischen Anspielungen dem Hauptthema der Oper dienen: dem Alter und dem „kompromisslosen, unaufhaltsamen Fortschreiten der Zeit“. Was die Wirkung auf das Publikum angeht, ist Abendsonne eher eine dichte, zum Nachdenken anregende Erfahrung als leichte Unterhaltung. Es fordert seine Zuhörer auf, sich mit existenziellen Fragen auseinanderzusetzen, Mehrdeutigkeiten zu tolerieren und ihren eigenen Platz im Fluss des Lebens und Sterbens zu erkennen. Dabei verzichtet sie jedoch auf Moralpredigten: Die absurden und grotesken Momente der Oper schaffen Raum für Lachen und Entspannung. So hat beispielsweise das Zusammenspiel zwischen den Rentnern und den jungen Pflegekräften einen fast schon skurrilen Charakter – auch wenn dabei tiefgreifende Themen wie Krankheit, Sterblichkeit und Erneuerung behandelt werden.
Diese klangliche Fluidität ist eine der größten Stärken der Oper: Sie hält das Publikum in Atem und lässt kein einzelnes Register dominieren. Die kammermusikalische Besetzung sorgt für klare Stimmen und ermöglicht theatralische Nuancen: Durch die intime Instrumentierung wird das Publikum in einen lebendigen Raum hineingezogen und nicht in ein fernes Spektakel. Das Produktionsteam – die musikalische Leiterin Antanina Kalechyts, das Ensemble PHACE und das gesamte Kreativteam, einschließlich Video, Choreografie, Kostüme und Beleuchtung – setzt diese Vision konzentriert um.
Darüber hinaus wird die Oper durch ihre Einbindung in das Programm von Wien Modern 2025 in einen Kontext zeitgenössischer Innovation gestellt. Sie veranschaulicht, wie modernes Opernschaffen relevant sein kann – indem es unsere demografischen Realitäten (alternde Gesellschaften), institutionelle Räume (Pflegeheime), bioethische Fragen (unheilbare Krankheiten, Wiedergeburt) und Generationsbeziehungen thematisiert und dabei eine reichhaltige Musiksprache verwendet, die mit der Vergangenheit der Oper in Dialog tritt. Für ein Festival, das sich der „Neuen Musik” und experimentellen Formen widmet, bietet Abendsonne einen zugänglichen, aber intellektuell anspruchsvollen Einstieg: Die Handlung ist klar, die Figuren sind wiedererkennbar, doch die Struktur und der Klang fordern das Publikum heraus.
Man könnte das Werk wegen seiner Dichte kritisieren – manche Zuhörer empfinden die schnellen Wechsel zwischen Tragik und Komik oder die vielschichtigen Zeitbereiche möglicherweise als verwirrend. Die häufigen Anspielungen auf die Operngeschichte könnten diejenigen ablenken, die mit solchen Stilmitteln nicht vertraut sind. Allerdings lohnen sich gerade diese Merkmale für wiederholtes Hören und Nachdenken. Die Mischung aus Video und Choreografie in der Inszenierung mag manchmal von der musikalischen Linie ablenken, doch diese Interdisziplinarität steht wohl im Einklang mit dem Thema der Oper, nämlich der Verflechtung von Zeit und der Konvergenz von Lebenszyklen. Insgesamt erhebt Abendsonne Anspruch auf eine Oper unserer Zeit: Sie ist nicht auf großartige Spektakel oder traditionelle „historische“ Erzählungen angewiesen, sondern verwurzelt in einem intimen institutionellen Raum.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Abendsonne ein mutiger und nachdenklicher Beitrag zur zeitgenössischen Oper ist. Das Drama spielt in einer vertrauten und endgültigen Umgebung – einem Altenheim –, eröffnet jedoch Raum für weitreichende Reflexionen über Leben, Tod, Zeit und das, was danach kommt. Durch Tornquists prägnanten Text und Skweres' reichhaltige, anspielungsreiche Musik wird das Publikum in einen Grenzbereich entführt, in dem Generationen aufeinandertreffen, Absurdität und Würde nebeneinander existieren und die „Abendsonne” des Lebens auch die Verheißung auf etwas darüber Hinausgehendes in sich bergen kann. Für alle, die sich für die sich wandelnden Formen der Oper interessieren, dafür, wie Musiktheater die grundlegendsten Fragen der Menschheit von heute aufgreifen kann, ist Abendsonne eine Oper, die man sehen, hören und über die man nachdenken sollte.
**************************************************************
Jugendstiltheater Wien [ENA]. In Abendsonne (lit. “Evening Sun”), we are invited into a melancholic, ironically tinted chamber-opera world set in a retirement residence named Residenz Abendsonne. Here, aging, mortality, rebirth and the fraught intersections between generations play out in a setting at once mundane and metaphysical. The production opens with a group of elderly residents at the final stop of their lives.
Yet from this stillness arises an incipient chaos when one resident, a retired physician, receives a cancer diagnosis and begins to plot his “rebirth” with the aid of friends and a young caregiver. The libretto by Kristine Tornquist features a layered structure, with three interwoven stories or “time-realms”: the not yet born, the living and the dead. These domains converge in the residence’s liminal space: young and old living souls, evoked memories of the dead and the incipient existence of the unborn meet in a setting that lies between existence and non-existence.
Time in Abendsonne is non-linear and elastic; the boundaries between childhood, birth, life and death blur and the aging protagonists attempt to negotiate the passage of time with varying degrees of humour, denial and insight. In this way the retirement home becomes a micro-world of the human life-cycle, including its grotesque, absurd and tragic dimensions. Composer Tomasz Skweres calls the work “a tragicomedy of survival” and notes that the score deliberately draws on references from operatic and stylistic traditions—to give musical shape to the unstoppable advance of time.
Musically and theatrically, Abendsonne distinguishes itself by its hybridity and its constant oscillation between seriousness and absurdity. The instrumentation is chamber-sized: the ensemble includes flute, clarinet, saxophone, horn, trombone, accordion, harp, strings and two percussionists. Such instrumentation allows for an intimate yet richly textured sonic world, well-suited to the opera’s psychological interiority and shifting registers. Skweres’s approach integrates stylistic allusions—moments that evoke classical opera, baroque or nineteenth-century techniques—yet twisted through a modern lens.
He explains that the frequent “quick switches between grotesque, absurd motives and tragic-dramatic moments” are emblematic of the work’s dramaturgy. In other words: the audience is frequently unsettled, moved and amused all at once. The staging, under Tornquist’s direction, further heightens this effect. The set by Markus Liszt and Michael Liszt situates the narrative in the Jugendstiltheater am Steinhof (the performance venue) and uses an environment that is simultaneously sterile and uncanny: a retirement residence suffused with theatricality.
Choreography by Bärbel Strehlau and the video-programming by Germano Milite add layers of movement and mediated presence, transforming the residence into a stage of temporal flux, where past, present and future swirl together. The costumes by Nora Scheidl and the light design by Alexander Wanko further reinforce the thematic contrasts: aging vs freshness, routine vs revelation, stillness vs motion. One of the most compelling aspects of Abendsonne is how it addresses aging and death not as mere melancholia but as a terrain of humour, absurdity and possibility. The idea of the retired doctor plotting a “rebirth” in the last stage of life opens a space for reflection about agency, transformation and what remains possible even as time runs out.
The libretto’s language and the musical score work in tandem to create an atmosphere that is at once intimate and expansive. Tornquist’s text refuses sentimental comfort, instead placing its characters in off-kilter dialogues, monologues and choral fragments that range from reflective to comic to surreal. The composer’s score mirrors this: at times the music seems to quote or evoke familiar operatic tropes, but these citations are bent or disrupted; what feels like a waltz may lurch into a percussive interjection, a lyrical passage may yield to an outburst of dissonance. The interplay of tradition and innovation thus becomes a meta-reflection on time itself: musical history folded into the present, much as the elderly and youthful figures.
Skweres himself comments that his musical allusions serve the main theme of the opera: age and the “uncompromising, unstoppable progression of time.” In terms of audience impact, Abendsonne is a dense, thought-provoking experience rather than light entertainment. It asks its listeners to engage with existential questions, to tolerate ambiguity, to recognise their own place in the flux of living and dying. Yet it does so without moralising: the opera’s absurd and grotesque moments open space for laughter and release. For instance, the interplay between the retirees and the young caregivers retains a quasi-farce quality—even as deeper issues of illness, mortality and renewal are on the table.
This tonal fluidity is one of the opera’s strongest cards: it keeps the audience off balance, never allowing a single register to dominate. he chamber scale ensures clarity of voices and the possibility for theatrical nuance: the intimate instrumentation means the audience is drawn into a lived-in space rather than distant spectacle. The production team—musical leader Antanina Kalechyts, the ensemble PHACE, and the full creative team including video, choreography, costume and lighting—bring this vision into focused realization.
Moreover, the opera’s placement within the Wien Modern 2025 programme situates it in a context of contemporary innovation. It exemplifies how modern opera can be relevant—addressing our demographic realities (aging societies), institutional spaces (nursing homes), bio-ethical questions (terminal illness, rebirth), and generational relations—all while using a rich musical language that dialogues with opera’s past. For a festival dedicated to “Neue Musik” and experimental forms, Abendsonne offers an accessible but intellectually rigorous gateway: its story is clear, its characters recognisable, yet its structure and sound challenge the audience.
One might critique the work for its density—some listeners may find the rapid shifts between tragic and comic, or the layered time realms, disorienting. The frequent allusions to operatic history risk distracting those not familiar with such tropes. However, these same features reward repeated listening and reflection. The staging’s mixture of video and choreography may divert attention from the musical line at times, yet this interdisciplinarity is arguably in tune with the opera’s theme of temporal interweaving and life-cycle convergence. In sum, Abendsonne stakes a claim for an opera of our times: not reliant on grand spectacle or traditional “historical” narrative, but rooted in an intimate institutional space.
In conclusion, Abendsonne stands out as a bold and thoughtful contribution to contemporary opera. It locates its drama in the familiar and the final—an elderly home—but opens that space to expansive reflection on life, death, time and what comes after. Through Tornquist’s incisive text and Skweres’s richly allusive music, the audience is invited into a liminal realm where generations meet, where absurdity and dignity coexist, and where the “evening sun” of life may also harbour the promise of something beyond. For anyone interested in the evolving forms of opera, in how music theatre can engage the most fundamental human questions today, Abendsonne is an opera to watch, listen and reflect upon.