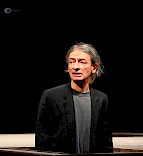Oper in Wien, 27.10.2015, Dominik Troger
Sisyphos besucht die Wiener Universität
Anlässlich 650 Jahre Wiener Universität wird der große Festsaal des Hauptgebäudes an der Wiener Ringstraße mit dem Musiktheaterwerk „Sisifos“ bespielt. Die Uraufführung fand am 23. Oktober statt, Vorstellungen gibt es noch bis einschließlich 27. Oktober.
Bernhard Lang erforscht musikalisch nach wie vor „Wiederholungen“ und „Differenzen“. Er folgte mit seinem neuen Stück „Hermetika VI – Sisyphos-Fragmente“ einer Idee von Kristine Tornquist, die durch das sirene Operntheater unermüdlich die freie Wiener Opernszene mit neuen Stücken versorgt – und dabei gedanklich konzeptionell vorgehend immer wieder neue Themenkreise erschließt. Aktuell hat sich die opernaffine Sirene starken „mythischen“ Männern verschrieben: Auf „Gilgamesch“ im Frühjahr folgte jetzt „Sisifos“. Im November wird diese Themenstellung anhand zeitgenössischer politischer Verwerfungen in Russland befragt.
Ausgangspunkt für Lang ist die Sisyphos-Stelle in der „Odyssee“ („Auch den Sisyphos sah ich (...)“). Lang hat den Text adaptiert, zerlegt und neu zusammengesetzt (und der Titel „Hermetika“ lässt vermuten, dass er dabei auch an alte magische Praktiken gedacht hat, in denen das vom semantischen Sinn befreite Wort zum geheimen Gottesnamen wird). Die nur einige Verszeilen umfassende Textstelle wurde von Lang zu sieben Chorstücken verarbeitet, die jeweils etwa sieben Minuten dauern. Lang nennt es im Programmheft: „sieben Vertonungen des Gleichen, in etwa gleicher Länge“.
Der Komponist lässt Phrasen wiederholen, drei Mal, vier Mal, ehe sich Veränderungen einschleichen, „minimalistisch“ – aber ohne dabei die rasante Erregtheit von „Minimal Music“ zu erzeugen, wie sie einen bei John Adams oder Philip Glass begegnet. Bei Lang geht es gesetzter, um nicht zu sagen „gregorianischer“ zu. 60 Choristinnen und Choristen machen ganz alleine Musik, bauen ein Himmelsgewölbe aus menschlicher Stimme, das in dieser Produktion von der umlaufenden Galerie des Universitätsfestsaales in überraschend weihevollen Variationen auf das Publikum herniederschwebte. Geht es um eine Art von Gebet, geht es um Trance, geht es um eine Form der Entrückung, die seltsam „unzeitgenössisch“ wirkt und dazu anregt, die Augen zu schließen, um nur noch zu zu hören?
Solch kontemplativer Wahrnehmung ward das handfeste Theatergespür von Kristine Tornquist gegenübergestellt, die diese gesungene „Metaphysik“ in einem bühnenpraxisorientierten „Schöpfungsakt“ zu einer angreifbaren „Welt“ ausdifferenziert hat. Das Publikum im recht dunkel gehaltenen Festsaal begegnete auf der raummittig gelegenen, kleinen und leeren Bühne zwei Schauspielern, die Texte von Tornquist sprachen, und die Geschichte des durch Äonen steineschleppenden Sisyphos auf das Menschheitsgeschichte umfassende Wechselspiel von Krieg und Frieden bezogen. Vom Ritter in blanker Rüstung über den Landsknecht bis zum kriegschürenden Kapitalisten spannte sich der Bogen über sieben Stationen, in denen Sisyphos auf der Suche nach vermeintlicher Freiheit für beständig neue kriegerische Auseinandersetzungen sorgte. Am Schluss stand wohl die Weltzerstörung – „Es gibt keine Insel mehr“ – und die beiden Schauspieler flüchteten von der Bühne, flüchteten aus dem Saal „in die Utopie“.
Wenn die Chormusik ertönte, dann setzten die Schauspieler pantomimische Mittel ein, bedrohlich, witzig, immer sehr treffend im Charakter gezeichnet: der Imperialist mit Tropenhelm, der k.k. Offizier mit kleinem Weihnachtsbaum, den ein Soldat umrobbt, aus der Bühne herausgeklettert wie aus einem Schützengraben. Diese Bühne hatte es „in sich“: eine inwendig geräumige „Box“, mit Luken auf der Plattform für die Auf- und Abtritte. Die Schauspieler mussten die Bühne nie verlassen, wechselten im Bühnenboden die Kostüme, tauchten manchmal nur bis zum Oberkörper auf, verschwanden wieder wie in den Boden tauchend – eine sehr kreative, spielortbezogene Lösung.
Der Mythos von Sisyphos ist ein Thema, das Bibliotheksregale füllt, aber bezogen auf diesen Abend genügte, dass trotz der Heterogenität der eingesetzten Mittel – ein großer Chor, der nahezu unsichtbar auf der Galerie saß und die kleine Bühne mit zwei Schauspielern – alle Beteiligten zu einem sinnvollen Ganzen verschmolzen.
Der Saal war etwa zu zwei Drittel gefüllt und etwas kühl klimatisiert. Die Anwesenden spendeten dankbaren Schlussapplaus. Keine Pause teilte die insgesamt eher kurze Vorstellung.