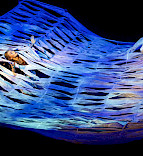Oper in Wien / Online Merker, 25.11.2023, Dominik Troger
Alice-Revue im Wunderland (pdf)
Das Wunderland befindet sich derzeit im Wiener Odeon. Nein, es handelt sich um keinen Weihnachtsmarkt, sondern um eine literarisch-musiktheatralische Vergnügung: Das Publikum darf die berühmte Alice bei ihren seltsamen Abenteuern begleiten.
Das sirene Operntheater und das Serapions Theater haben sich einem der bekanntesten (Kinder-)Bücher der Weltliteratur gewidmet: Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“. Von einem weißen Kaninchen verlockt, fällt Alice durch einen Kaninchenbau in die Tiefe ... die Tiefe ... die Tiefe ... und landet in diesem seltsamen Land, wo zum Beispiel sprechende Blumen, eine Grinsekatze und eine hinrichtungssüchtige Königin hausen. Ersonnen in den 1860er-Jahren wurde die Geschichte schon bald für die Bühne und etwas später für den Film entdeckt und die Zahl der Bearbeitungen hat inzwischen geradezu „barocke“ Ausmaße erreicht.
Auch Werke für das Musiktheater sind auf Carrolls Alice-Bücher komponiert worden, ausgehend von Walter Slaughters 1886 uraufgeführter „Alice in Wonderland“, ein „Dreamplay for Children“. An zeitgenössischen Bearbeitungen gibt es zum Beispiel: die 1992 in Oxford uraufgeführte Oper des britischen Sängers und Komponisten Roger Williams; die 2007 bei den Münchner Opernfestspielen uraufgeführte Oper „Alice in Wonderland“ von Unsuk Chin; die 2013 von der Opera Holland Park aufgeführte Bearbeitung des britischen Komponisten Will Todd; eine Fassung des auf Kinderopern spezialisierten Komponisten Pierangelo Valtinoni, die 2021 in Hongkong uraufgeführt wurde. Allein mit den Genannten ließe sich schon ein „Alice im Wunderland“-Musiktheaterfestival bestreiten, in dem natürlich auch der neueste Beitrag zu dieser langen Bearbeitungshistorie seinen Platz hätte: „Alice“ von Kurt Schwertsik in der Textfassung von Kristine Tornquist, deren englisches Libretto auf den beiden Bänden „Alice im Wunderland“ und „Alice hinter den Spiegeln“ basiert.
Der Stoff scheint nach wie vor eine starke Magie auszuüben, die Verlockung, Alice von ihrem Buchseitendasein zu befreien, ihr eine „Auferstehung“ im dreidimensionalen Raum zu ermöglichen, ihr einen Körper zu verleihen und eine Stimme, scheint ungebrochen. Vielleicht verbirgt sich dahinter der Wunsch, Alice einmal im „wirklichen Leben“ zu begegnen, um an ihrer Flucht aus einer von Formalismen geprägten „Normalität“ teilzuhaben, samt ein bisschen Nervenkitzel traumhafter und albtraumhafter Verwicklungen. Oder beschreibt das Wunderland gar einen Ort der Initiation – bei dem Kinder erwachsen und Erwachsene wieder Kinder werden?
„Alice“ wurde im Rahmen einer „interdisziplinären“ Zusammenarbeit umgesetzt. Das sirene Operntheater hat sich mit dem Serapions Theater zusammengefunden, Musiktheater hat sich mit dem gepflegten Stil pantomimischer und tanzgeprägter Performance zusammengetan. Die „Alice“, der das Publikum im Odeon begegnet, beruht auf der stark gekürzten Handlung von Carrolls Texten (und Ornithologen werden traurig sein, der Dodo hat es nicht auf die Bühne geschafft). Auf rund 100 Minuten Aufführungsdauer verteilen sich 26 kurze, lose miteinander verbundene Szenen, in denen die Handlung stark verdichtet nacherzählt wird. Die Librettistin Kristine Tornquist merkt im Programmheft zur Aufführung dementsprechend an, dass es sich um keine „Oper“ handle, sondern um eine „Revue für die unterschiedlichen Figuren“.
So haben sie alle ihren Auftritt mit Alice als gemeinsamem Zentrum: das Kaninchen, die Grinsekatze, der Hofstaat, die sprechenden Blumen, die Raupe, die Teegesellschaft und andere mehr. Alice befindet sich die meiste Zeit auf der Bühne und wird von einer Schauspielerin gespielt. Die übrigen Figuren werden durch Gesangssolisten und die Künstler des Serapions Ensembles dargestellt, dabei werden Figuren auch verdoppelt. Alice bleibt eher passiv, erst am Schluss, wenn es um die Flucht aus dem sich immer bedrohlicher gebärdenden Phantasieland geht, ergreift sie die Initiative.
Die Inszenierung, die Kristine Tornquist zusammen mit Max Kaufmann, dem künstlerischen Leiter des Serapions Theaters, erstellt hat, möchte aber nicht nur das Märchen erzählen, wie es im Libretto vorgegeben ist, sondern auch eine Metaebene ansprechen, die das Verhältnis des Autors zu seiner Romanfigur problematisiert – und dabei vielleicht auch die Beziehung des Autors Lewis Carroll alias Charles L. Dodgson zu Alice Liddell meint. Am Beginn wird in einer pantomimischen Einleitung ohne Musikbegleitung durch das Ensemble der „Schöpfungsakt“ des Autors symbolisch nachvollzogen. Das Endprodukt ist ein Buch, das den ganzen Abend lang vor der kreisrunden, leicht erhöhten Spielfläche liegt, die in die leere, flache Bühnenwelt des Odeons gebaut wurde.
In diesem Buch wird immer wieder geblättert und der Autor mischt sich selbst unter die Figuren. In der Szene mit der Raupe wird er zum Beispiel eine (Opium)-Pfeife rauchen und als „Einflüsterer“ der Raupe deutlich machen, wer sich hinter diesen Phantasiegeschöpfen verbirgt. Und Alice atmet den Rauch ein, der aus dem großen schwarzen Maul der großen weißen Raupe hervorquillt – und vielleicht soll damit angedeutet werden, das Lewis Carroll alias Charles L. Dodgson seiner Alice Liddell auch Erfahrungen ermöglicht hat, von denen Eltern meist nicht so begeistert sind. Um den Bezug zwischen Buch und Handlung noch deutlicher zu machen, sind außerdem alle Kostüme aus Papier gefertigt, kleinere Requisiten werden aus Papier gefaltet, insgesamt eine optisch sehr reizvolle Idee.
Der Gesamteindruck bleibt trotz dieser szenischen Verklammerung über die Carroll-Alice-Beziehung lose, findet die szenisch entwickelte Metaebene im Libretto doch keine Entsprechung. Für eine schwungvolle Revue fehlt es den Szenen außerdem zu oft an einer, auch musikalisch ausformulierten, „Zuspitzung“. Man könnte sich die etwas verquere Frage stellen, ob „Alice“ vielleicht zu wenig „Revue“ ist, um „Revue“ zu sein, obwohl sie doch schon zu viel „Revue“ ist, um „Oper“ genannt zu werden. So bleibt mehr eine Ansammlung einzelner „Bilder“ in Erinnerung, die zum Teil durch ihre starke imaginative Wirkung überzeugen – wie zum Beispiel die aus acht Personen gebildete Grinsekatze, die sich kurz zu homogener anschmeichelnder Einheit formt oder die schon erwähnte große weiße Raupe mit ihrem schwarzen Maul und ihrer gemütlichen Schläfrigkeit, oder der Tränensee, ein großes, auf der Bühne ausgespanntes, löchriges Tuch, in dem sich Alice verfängt. Erst gegen Schluss, wenn die Königin – musikalisch wirkungsvoll unterstrichen – im Zuge des Krocketspiels zu einem „Todesurteilstanz“ ansetzt, wird spürbar, dass von diesen Figuren auch eine Gefahr ausgeht. Dann färbt sich die Spielfläche mit blutigrot projizierten Strichen und die Königin dreht sich effektvoll in ihrem weißen, mit reifrockähnlichen Ausbuchtungen verzierten Kleid.
Die Musik von Kurt Schwertsik hat Alice in liebenswürdigen Eklektizismus gekleidet, ist ihr mit der Behutsamkeit eines Großvaters begegnet. Dabei ist das Orchester gar nicht so klein, das neben der Bühne im Halbdunkel Aufstellung genommen hat. Es gibt Streicher und Bläser, sogar mit Trompeten und Posaunen, es finden sich ein Klavier und Schlagwerk. Diese musikalische „Fürsorglichkeit“ einer mit Liebe erinnerten Märchenfigur gegenüber, hat dazu geführt, dass eine lyrische Grundhaltung vorwiegt, manchmal etwas ironisch unterlegt – ein Akkordeon gibt es schließlich auch, und eine Trommel begleitet militärisch den Auftritt der königlichen Familie. Schwertsik bestellt einen gepflegten musikalischen Garten, pflanzt mit impressionistischem Hauch vokalisierende Blumen, erinnert Wiener Klassik ebenso wie er eine fein gewobene Brittensche Streichersehnsucht erahnen lässt (sozusagen als englisches „Seelenkolorit“). Und der Beginn klingt wie „Filmmusik“ – ein „Thema“, das im Epilog wieder auftaucht, um den Abend zu runden. Die viele Stile subsumierende Musik bleibt durchwegs sehr anschaulich.
Ana Grigalashvili gab die vom Wunderland verzauberte Alice und bildete das Zentrum eines erfahrenen Ensembles, das sich aus stimmgeschmeidigen Gesangssolisten und körpergeschmeidigen Mitwirkenden des Serapions Theaters zusammensetzte. Am Pult des differenziert und dynamisch gut abgestimmt spielenden Roten Orchesters wirkte François-Pierre Descamps. Das Publikum spendete im nahezu bis auf den letzten Platz gefüllten Odeon viel Applaus.
Die Uraufführung ist am 23. November über die Bühne gegangen, obige Anmerkungen beziehen sich auf die zweite Vorstellung. Die Produktion steht noch bis Ende Dezember auf dem Spielplan.